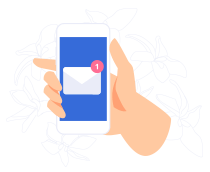Viren bestehen nur aus DNA oder RNA und manchmal aus einer umhüllenden Proteinkapsel oder Biomembran. Es ist also fair zu sagen, dass wenig los ist. Trotzdem gibt es in den Ozeanen eindeutig Lebewesen, die sich von diesem Etwas zu ernähren scheinen. Zu diesem Schluss kommen Julia Brown vom Bigelow Laboratory for Ocean Sciences in East Boothbay und ihr Team aus ihren Studien im Mittelmeerraum und im Golf von Maine. In den „Frontiers in Microbiology“ beschreiben sie ozeanische einzellige Organismen, die sehr wahrscheinlich Viren aufnehmen und sie zur Deckung ihres Energiebudgets verwenden..
Die von ihnen analysierten Choanoflagellaten und Picozoen sollen die ersten Organismen sein, die als Raubtiere von Viren fungieren, sie aktiv nutzen und nicht nur als Nebenprodukt der Einnahme essen. Für ihre Studie sequenzierten Brown und Co die DNA von etwa 1.700 verschiedenen Protisten, die sie aus dem Meerwasser herausfilterten. Neben der Bestimmung der Arten ging es auch darum, was sie essen. Die Biologen entdeckten daher auch große Mengen an bakteriellem genetischem Material und deren Viren.
Überraschenderweise fanden die beiden Gruppen Choanoflagellates und Picozoa nur Virus-DNA, aber keine bakterielle DNA. Beifangbakterien von infizierenden Viren wurden daher eliminiert; Darüber hinaus haben die nur drei Mikrometer großen Picozoen so kleine Essgeräte, dass selbst Bakterien zu groß dafür sind. Die einzelligen Organismen waren jedoch auch nicht infiziert, da sie nach bisherigem Kenntnisstand hauptsächlich Bakterien enthalten, die Viren infizieren. Die einzelligen Organismen dienen daher höchstwahrscheinlich nicht als Wirte, sondern haben die Krankheitserreger als Nahrungsquelle angesprochen.
„Viren sind relativ reich an Phosphor und Stickstoff, daher dienen die Protisten als gute Ergänzung zu ihrer kohlenstoffreichen Ernährung mit organischen Kolloiden oder kleinen Zellen“, sagt Brown. Die Folgen dieser Virusschädigung für das Ökosystem sind ebenso unklar wie der Einfluss dieser Viren auf das Erbgut der einzelligen Organismen. Follow-up-Forschung sollte helfen, dies zu klären.