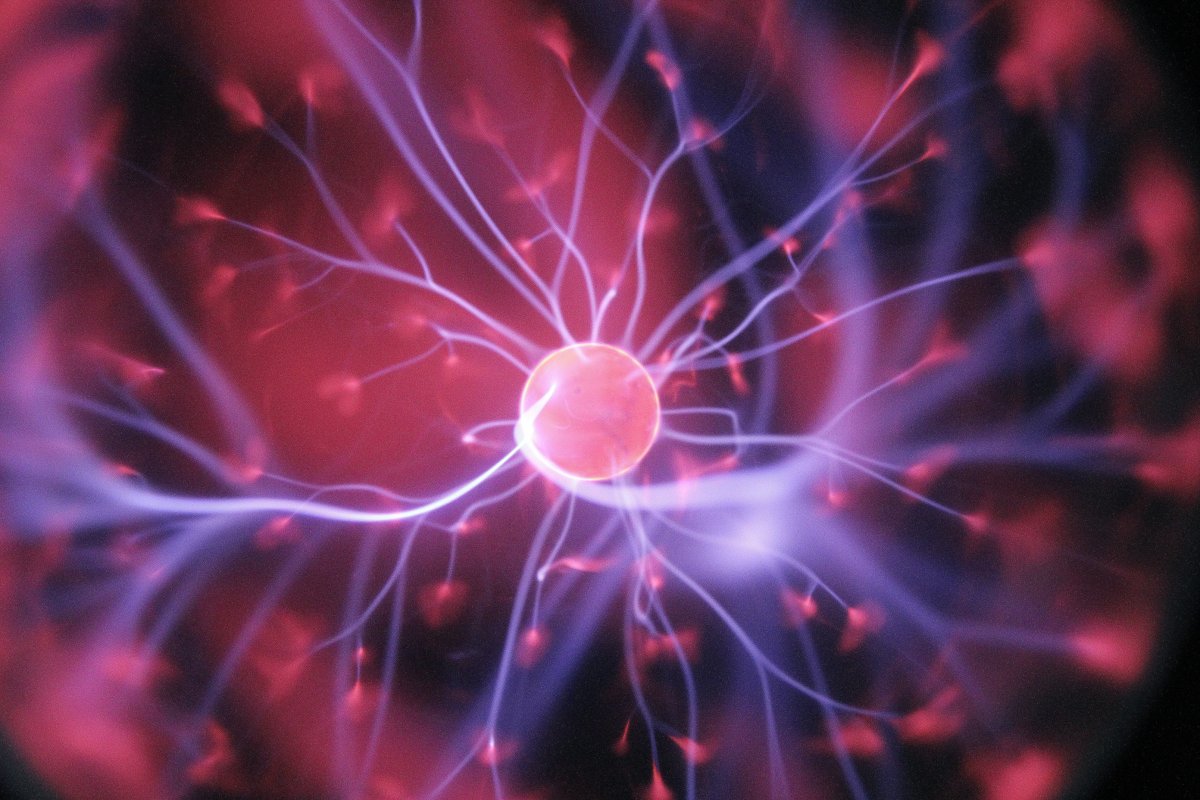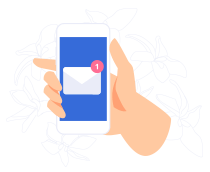Künstliche Synapsen können die Arbeitsprozesse eines Gehirns nachahmen. Forscher der Stanford University haben dies bereits 2017 mit experimentellen Komponenten demonstriert: Neuronale Lernprozesse konnten effizient und – was besonders wichtig ist – bei niedriger Energie simuliert werden. 2019 wurde auch gezeigt, wie neun dieser künstlichen Synapsen gleichzeitig gesteuert werden und miteinander kommunizieren können.
Elektrochemischer Kontakt zwischen Gehirn und Maschinerie
Jetzt kündigt Stanford zusammen mit Istituto Italiano di Tecnologia IIT und TU Eindhoven zukünftige Fortschritte an: Die elektrochemische Kommunikation mit Biohybrid ist möglich. Insbesondere: künstlich hergestellte Synapsen können mit lebenden Zellen kommunizieren. Die im Gehirn verwendeten Geräte arbeiten normalerweise mit elektrischen Signalen, um Nachrichten vom Gehirn zu erkennen und zu verarbeiten. Dieser Schritt kann mit dem neuen Verfahren eines Tages beseitigt werden.

Ein Modell des nervösen Gehirns.
(Bild: Foto von Robina Weermeijer auf Unsplash)
Kommunikation ist ein „kleiner erster Schritt“ in Richtung der Kontaktpunkte verbesserter Maschinen, kommentierte Alberto Salleo, Professor für Materialwissenschaften an der Stanford University und einer der Autoren des Papiers. Scott Keene, Co-Autor und Doktorand der Stanford-Doktorandin, bemerkt: „In einer biologischen Synapse wird im Grunde alles durch chemische Wechselwirkungen an der synaptischen Verbindung gesteuert. Wenn Zellen miteinander kommunizieren, ist es immer chemisch.“ Die Tatsache, dass künstliche Synapsen mit der natürlichen Chemie des Gehirns interagieren können, verspricht nun weitere Vorteile.
Konstruktion einer künstlichen Synapse
Künstliche Synapsen kommunizieren nicht nur mit Elektrizität, sondern auch elektrochemisch mit Neuronen. Zu diesem Zweck werden zwei weiche Polymerelektroden verwendet, zwischen denen sich ein kleiner „Graben“ befindet. Es ist mit einer Elektrolytlösung gefüllt – basierend auf synaptischen Lücken im Gehirn.
Wenn lebende Nervenzellen in diesen Elektroden platziert werden, reagieren die Neurotransmitter in den Gehirnzellen auf sie und produzieren Ionen. Die Ionen wandern durch die Gräben zur zweiten Elektrode und bilden eine Bindung. Diese Verbindungen wurden im Experiment sogar teilweise erhalten, was dem natürlichen Lernprozess im Gehirn entspricht. Bei digitalen Computern funktioniert das anders: Hier werden Daten zuerst verarbeitet und erst dann in den Speicher verschoben.

Alberto Salleo mit einem Studenten.
(Bild: LA CICERO / STANFORD NEWS SERVICE)

Das Studienpapier wurde in der Zeitschrift Nature Nature veröffentlicht. Die Richtung, in der weitere Forschung mit diesen Erkenntnissen durchgeführt wird, ist derzeit offen. Denken Sie an die Entwicklung von Computern, die vom Gehirn inspiriert sind, oder an neue Schnittstellen zwischen Gehirnprozessen und Maschinen, so Forscher.
(BSC)